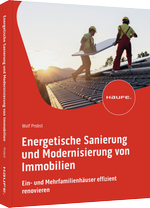"Sanierung light" analog zum Gebäudetyp E?

Der Gebäudesektor ist für 36 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das Bundes-Klimaschutzgesetz sieht vor, dass die Emissionen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden, bis 2024 soll der Sektor klimaneutral sein. Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn der Wohnungsbestand mit hohem Tempo nachhaltig energetisch saniert wird.
Das Immobilienhaus Aengevelt führt den anhaltenden Rückgang der Sanierungsaktivitäten unter anderem auf gesetzliche Regelungen zurück und empfiehlt die Zulassung einer "Sanierung light" analog zum Gebäudetyp E im Neubau.
Rückgang der Sanierungsdynamik: mögliche Gründe
Eine aktuelle Umfrage von Aengevelt Immobilien zeigt, dass bei Sanierungen mit wenig Dynamikzuwachs zu rechnen ist. Nur 24 Prozent der befragten Eigentümer prognostizieren eine Zunahme der Investitionen in die Modernisierung und Instandsetzung von Bestandswohnungen. Bei rein energetischen Sanierungen ist der Anteil mit 34 Prozent etwas höher. Das wird auf diese Gründe zurückgeführt:
- § 48 Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) schreibt hohe Dämmstandards vor. Bei diesen Anforderungen unterbleiben Sanierungen oft ganz. "Light"-Dämmungen könnten laut Aengevelt bis zu 80 Prozent der gesetzlichen Standards erreichen.
- Das GEG 2024 hat zu einer Verunsicherung bei vielen Gebäudeeigentümern geführt. Sanierungsinvestitionen werden eher vorgenommen, wenn die Rahmenbedingungen langfristig auskömmlich und verlässlich sind.
- Zur Verunsicherung hat auch die Diskussion über eine Sanierungspflicht auf EU-Ebene beigetragen, die viele Eigentümer zögern lässt, Investitionen vorzunehmen, die sich in naher Zukunft als falsch erweisen könnten.
- Die Umrüstung auf Fernwärme wird durch mangelnde lokale Verfügbarkeit, überteuerte Anschlusskosten und Abhängigkeit vom Versorger gehemmt.
- Die steuerlichen Regelungen zum anschaffungsnahen Erhaltungsaufwand führen dazu, dass Erwerber von Bestandsimmobilien häufig auf eine umfassende Sanierung verzichten, weil sie die Kosten nicht sofort steuerlich geltend machen, sondern nur über eine Haltefrist von 50 Jahren abschreiben können, wenn sie innerhalb von drei Jahren ab Erwerb die Schwelle von 15 Prozent der Anschaffungskosten überschreiten.
- Seit der Verschärfung des § 559 BGB unterlassen viele Eigentümer Modernisierungsmaßnahmen, weil die Miete nur noch um acht Prozent der Kosten erhöht werden kann, wobei zusätzlich Einschränkungen und Kappungsgrenzen gelten.
- Die Mehrheit der Gebäudeeigentümer sind Rentenempfänger: Diese Eigentümer sind mit der Planung, Ausführung und Finanzierung von Sanierungen häufig überfordert und rechnen nicht damit, die Amortisation der Investition noch zu erleben.
Eine Ausnahmeklausel für energetische Maßnahmen bei der steuerlichen Regelung des anschaffungsnahen Erhaltungsaufwands könnte laut Aengevelt flankierend zu einer "Sanierung light"-Lösung helfen, die Sanierungsquote zu steigern, ebenso wie die Rücknahme der Einschränkungen von sanierungsabhängigen Mieterhöhungsmöglichkeiten.
Sanierungsquote auch 2025 rückläufig
Die Quote für energetische Sanierungen im deutschen Gebäudebestand mit rund 19,5 Millionen Wohngebäuden ist im Jahr 2025 auf 0,67 Prozent gesunken – nach 0,69 Prozent im Vorjahr, 0,70 Prozent 2023 und 0,88 Prozent im Jahr 2022 ist das ein neuer Tiefpunkt. Um die vereinbarten Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen, müsste die jährliche Sanierungsrate bei rund zwei Prozent liegen.
Auch die Quote für die mehr als zwei Millionen Nichtwohngebäude ist rückläufig mit 0,92 Prozent im Jahr 2025 (Vorjahr: 0,95 Prozent).
Die Sanierungsquote wird im Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle (BuVEG) von B+L Marktdaten Bonn ermittelt. Sie ist die zentrale Kennzahl für Maßnahmen im Bereich der energetischen Gebäudesanierung und damit ein wesentlicher Indikator für die Wärmewende in Deutschland.
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 260.000 Wohneinheiten saniert, 2024 waren es noch 265.000 und 2023 sogar 275.000. "Deutschland braucht nicht nur einen Bauturbo, sondern dringend auch einen Sanierungsbooster", sagte BuVEG-Geschäftsführer Jan Peter Hinrichs.
GEG-Reform lässt auf sich warten
Ende 2025 hatte der Koalitionsausschuss der Bundesregierung beschlossen, das GEG 2024, auch Heizungsgesetz genannt, zu reformieren und in Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) umzubenennen.
Wie die Änderungen genau aussehen, ist aber immer noch unklar. Eigentlich sollte die Novelle Ende Januar 2026 ins parlamentarische Verfahren, doch es geht nicht voran.
Für Immobilieneigentümer ist vor allem interessant, ob sich die Anforderungen beim Einbau neuer Heizungen ändern oder nicht. Derzeit müssen in diesem Fall 65 Prozent erneuerbare Energien für die Wärmeversorgung eingesetzt werden.
Wohngebäude verbrauchen zu viel Energie
Gemäß der Leitstudie "Aufbruch Klimaneutralität" der Deutschen Energie-Agentur (Dena) hätten 2025 jedoch 460.000 Wohneinheiten saniert werden müssen – bis 2030 müsste diese Zahl auf bis zu 730.000 steigen.
Hintergrund: Die Gebäude in Deutschland verbrauchen nach wie vor zu viel Energie; sie verursachen derzeit rund 30 Prozent aller CO2-Emissionen. Die energetisch schlechtesten Gebäude der Effizienzklassen G und H sind für 50 Prozent des gesamten Energieverbrauchs des Gebäudesektors verantwortlich.
Zwei Drittel aller Wohngebäude befinden sich in den Effizienzklassen D bis H und verbrauchen mehr als 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das
führt zu immer höheren Energiekosten für die Verbraucher und zu einem Wertverlust bei Immobilien von energetisch schlechten Gebäuden. Der Wertabschlag am Markt liegt mittlerweile bei bis zu 40 Prozent gegenüber sanierten Immobilien.
Klimaschutz im Gebäudesektor: wirtschaftlich tragfähig?
"Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft steht fest zu den Klimazielen. Klimaschutz im Gebäudesektor muss jedoch realistisch, sozial ausgewogen und wirtschaftlich tragfähig gestaltet werden", sagte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, bei Vorlage der Stellungnahme mit konkreten Vorschlägen zum Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. "Wir sprechen uns gegen politischen Druck aus, die Sanierungsrate zu erhöhen."
Bei Fortführung der aktuellen Sanierungsrate seien die Gesamtkosten für Energie- und Gebäudesystem geringer als bei einer künstlich beschleunigten Sanierung. Der Verband schlägt ein Vorgehen nach dem Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor vor. Konkret sollte die BEG-Förderung konsequent auf Einzelmaßnahmen ausgerichtet werden, statt teure Effizienzhausstandards zu fördern. Eine Experimentierklausel im Gebäudemodernisierungsgesetz könnte die CO2-Bilanzansätze für Wohnungsbestände als alternative Erfüllungsoption ermöglichen.
"Unser Appell lautet: Verlässlichkeit, Planbarkeit und soziale Balance sind der Schlüssel für erfolgreichen Klimaschutz im Gebäudebereich und für die Akzeptanz in der Gesellschaft", so der GdW-Präsident.
Das Problem für Wohnungseigentümer und Verwalter
"Beim Gebäudeenergiegesetz zeigt sich Anfang 2026 vor allem eines: maximale Verunsicherung bei minimaler Klarheit", schreibt der Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV). Während es im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot eindeutig hieß, dass das Heizungsgesetz abgeschafft werden soll, scheine nun niemand in der Bundesregierung mehr ernsthaft vom Kern des Gesetzes abrücken zu wollen.
Genau hier beginnt dem VDIV zufolge das Problem für Wohnungseigentümergemeinschaften und Immobilienverwaltungen. Während öffentlich über Änderungen gestritten werde, gelten die bestehenden Regeln fort. Die 65-Prozent-Vorgabe steht im Gesetz, kommunale Wärmepläne rücken näher, Förderbudgets schrumpfen. Technologieoffenheit werde versprochen, aber an Voraussetzungen geknüpft, die vielerorts nicht existierten.
"Diese Unsicherheit ist systemisch: Gesetzesänderungen werden angekündigt, ohne dass Zeitpläne halten", schreiben VDIV-Präsidentin Sylvia Pruß und Geschäftsführer Martin Kaßler. "Wer heute Beschlüsse vorbereitet, haftet faktisch für politische Unentschlossenheit." Dazu komme, dass nun auch noch der Druck der Judikative steige.
Klimaklage gegen Bundesregierung erfolgreich
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig bestätigte ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg, dass das im Oktober 2023 beschlossene Klimaprogramm der Bundesregierung die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes nicht vollständig erfüllt, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Es muss nachgebessert werden. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH).
Insbesondere bei den Treibhausgasemissionen sah das OVG eine Lücke von mindestens 200 Millionen Tonnen CO2. Die Bundesregierung müsse darauf achten, dass alle Maßnahmen des Klimaschutzprogramms prognostisch geeignet seien, die Klimaschutzziele zu erreichen und dabei die jährlichen Emissionsmengen einzuhalten. Gegen dieses Urteil hatte die Bundesregierung Revision eingelegt, über die der 7. Senat des BVerwG entschieden (Urteil. v. 29.1.2026, 7 C 6.24) hat.
Vertreter der Bundesregierung sagten in der Gerichtsverhandlung, dass schon Ende März 2026 ein neues Klimaschutzprogramm vorgelegt werden solle. Das Klimaschutzgesetz schreibt vor, dass eine neue Regierung das innerhalb von zwölf Monaten nach Beginn einer Legislaturperiode erledigen muss. Wegen des Scheiterns der Ampel-Koalition folgt auf das 2023er-Programm nun schon nach drei Jahren ein neuer Plan.
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Pflichten für Energieausweise ab Mai
Energetische Sanierung: Kosten von der Steuer absetzen
Modernisierung & Instandhaltung: Steuerliche Entlastung
Mieterhöhung nach Modernisierung und Sonderkündigungsrecht (Top-Thema)
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
209
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1761
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
143
-
Ladeinfrastruktur im Mehrparteienhaus: Die Förderung
115
-
Mitarbeiterwohnungen: Steuervorteile und Förderung
90
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
70
-
Verbot von Bleirohren: Letzte Frist läuft am 12. Januar ab
61
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
57
-
Lohnt sich die Prüfung zum Zertifizierten Verwalter?
512
-
Zweckentfremdung: Neues Gesetz in Schleswig-Holstein
48
-
"Sanierung light" analog zum Gebäudetyp E?
16.02.20261
-
Wo Planung auf Prävention trifft
13.02.2026
-
Kriminalprävention: Gegen Ängste
09.02.2026
-
Siemax: immowelt hat uns viele verkaufswillige Eigentümer vermittelt
02.02.2026
-
Kündigung von Mietvertrag bei häuslicher Gewalt
30.01.2026
-
Zwischen Leerstand und Wohnraummangel
30.01.2026
-
Planbarkeit ist die neue Währung
29.01.2026
-
Das bewegt die Wohnungswirtschaft im Jahr 2026
26.01.2026
-
Warum Vermieter mehr digitale Services bieten sollten
22.01.2026
-
Wie Wohnungsunternehmen bilanzieren müssen
22.01.2026