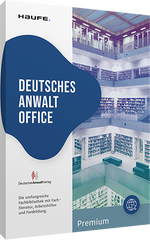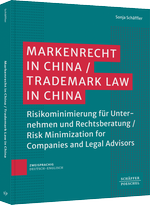Ein Grund für eine „Entziehung“ des gesetzlichen Richters im Sinne von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG kann nicht in jeder fehlerhaften Rechtsanwendung durch den Richter gesehen werden. Sonst müsste nach dem Ablehnungsrecht jede fehlerhafte Handhabung des einfachen Rechts durch den Richter zugleich als Verfassungsverstoß gelten, der nach dem Grundgesetz seine Auswechselung erfordert. Auch führt nicht jeder falsche Zungenschlag in Richtung einer Seite automatisch zur Befangenheit. Auch die Vorbefassung eines Richters mit vergleichbaren Rechtsfragen in anderen Verfahren begründet keine Besorgnis der Befangenheit (BVerfG, Beschluss v. 13.4.2017, 1 BvR 610/17).
Nicht jeder richterliche Ausrutscher rechtfertigt eine Ablösung wegen Befangenheit
Die Grenzen zum Verfassungsverstoß sind aber überschritten, wenn die Auslegung einer Verfahrensnorm oder ihre Handhabung im Einzelfall willkürlich oder offensichtlich unhaltbar sind oder wenn die richterliche Entscheidung Bedeutung und Tragweite der Verfassungsgarantie des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG grundlegend verkennt“ (BVerfG, Beschluss v. 25.7.2012, 2 BvR 615/11).
Wichtig: Eine Besorgnis der Befangenheit ist dann gegeben, wenn ein am Verfahren Beteiligter bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass hat, an der Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln. „Tatsächliche Befangenheit oder Voreingenommenheit ist nicht erforderlich; es genügt schon der „böse Schein“, d.h. der mögliche Eindruck mangelnder Objektivität (BGH, Beschluss v. 28.2.2018, 2 StR 234/16).
Tendenziöses Verhalten des Richters
Von einem zu einseitigen Verhalten ging das BVerfG bei einem richterlichen Verhalten aus, das die Zivilrechtsinstanzen noch für zulässig erachteten.
Beispiel: Ein Richter hatte einem auf Zahlung des Anwaltshonorars verklagten Ex-Mandanten damit gedroht, die Akte an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Der Beklagte hatte sich - ähnlich wie in einem Parallelverfahren gegen ein Arzthonorar – u.a. darauf berufen, der Anwalt habe nicht ordnungsgemäß abgerechnet, sich weisungswidrig verhalten, einen zu hohen Gegenstandswert sowie einen zu hohen Gebührensatz angesetzt. Der Richter sah wohl schon in dieser Parallelität einen Hinweis auf strafbares Verhalten und drohte mit dem Staatsanwalt. Das machte ihn nach Ansicht des BVerfG befangen, da dieser Verdacht nicht hinlänglich begründet war.
Der bloße Verweis auf die Lektüre der Akten, die den Verdacht nahelege, der Beschwerdeführer nehme entgeltliche Dienste Dritter in Anspruch, ohne diese bezahlen zu wollen, war jedenfalls unter den gegebenen Umständen laut BVerfG offensichtlich unzureichend. „Weshalb allein der Umstand, dass ein Verfahrensbeteiligter in mehr als einem Fall einer von Dritten wegen erbrachter Leistungen gegen ihn erhobenen Forderung entgegentritt, einen Straftatverdacht begründen soll, der eine richterliche Pflicht zu entsprechendem Hinweis auslösen und es damit zugleich rechtfertigen könnte, Strafanzeige gegen den Verfahrensbeteiligten zu erstatten oder ihm dies in Aussicht zu stellen“,
erschließe sich – so das Gericht - nicht einmal ansatzweise (BVerfG, Beschluss v. 25.7.2012, 2 BvR 615/11).
Schon Vorbereitungshandlungen können den Eindruck der Befangenheit begründen
In einer Grundsatzentscheidung hat das BVerfG eine lediglich im Stadium der Verfahrensvorbereitung vorgenommene richterliche Handlung zum Anlass genommen, dem Antrag auf Ablehnung der betreffenden Richterin wegen der Besorgnis der Befangenheit zu entsprechen. Gegenstand der Entscheidung des BVerfG war ein Verfahren vor dem SG, in welchem eine Krankenkasse einen Pfleger wegen Abrechnungsbetrugs verklagt hatte. Die Krankenkasse hatte zur Begründung ihrer Klage dem Gericht eine passwortgeschützte CD übersandt, die die staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte gegenüber dem Krankenpfleger enthielt. Die Krankenkasse hatte mit der StA abgesprochen, dass lediglich das Gericht Einsicht in die Ermittlungsakte erhalten sollte. In dem begleitenden Schriftsatz teilte die Krankenkasse gegenüber dem Gericht mit, das Gericht könne das Passwort über die StA erfahren, wovon das Gericht Gebrauch machte, ohne dass die Beklagtenseite hiervon in Kenntnis gesetzt wurde.
Das BVerfG hielt die Verfassungsbeschwerde gegen den vom SG abgelehnten Befangenheitsantrag für offensichtlich begründet. Art. 101 Abs.1 Satz 2 GG garantiere, dass der Rechtsuchende im Einzelfall vor einem Richter steht, der unabhängig, unparteilich und neutral urteilt. Das im konkreten Fall von der Richterin abgefragte Passwort diene ausschließlich der Entschlüsselung der CD, so dass die Richterin mit der Abfrage für sich selbst objektiv die Möglichkeit eröffnet habe, unter Ausschluss des Beklagten unmittelbar Einsicht in die Ermittlungsakte zu nehmen. Dies könne für eine Prozesspartei bei vernünftiger Würdigung den Eindruck einseitiger Verfahrensführung erzeugen und begründee somit die berechtigte Besorgnis der Befangenheit (BVerfG, Beschluss v.21.11.2018, 1 BvR 436/17).
Die nachträgliche Äußerung der Richterin, sie habe nie beabsichtigt, Akten dem Verfahren zugrunde zu legen, die der Beschwerdeführer nicht kennt, entkräften nach Wertung der Verfassungsrichter den Anschein der Voreingenommenheit nicht.
Deutliche Richterworte sind erlaubt
Manchmal sind auch Äußerungen der Richter während oder abseits mündlicher Verhandlungen Anlass für Befangenheitsanträge. In einem vom OLG Stuttgart entschiedenen Fall (Beschluss v. 29.3.2012, 14 W 2/12) hatte der Richter dem Anwalt des Gesellschafter-Geschäftsführers gesagt, sein Mandant „dürfe den Schwanz vor dem Rechtsstreit nicht einziehen“. Der Richter war enttäuscht darüber, dass wegen des Fernbleibens des Mandanten eine Lösung des Streits unter den Gesellschaftern nicht möglich war. Der Anwalt stellte daraufhin einen Befangenheitsantrag. Diesen wies das OLG zurück: Die Äußerung des Richters dürfe nicht isoliert betrachtet werden; vielmehr komme es auf den Zusammenhang an, in dem sie gefallen sei. Vorliegend habe die beklagte Partei von ihrem Standpunkt aus nach objektiven Maßstäben die Äußerung des Richters nicht dahin verstehen dürfen, dass dieser ihr gegenüber negativ eingestellt oder gar zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit ihrem Vorbringen nicht gewillt gewesen wäre.
Nicht immer haben die Richter Glacéhandschuhe an
Nicht immer fassen Richter bei ihrem oft nervenaufreibenden Bemühen um Rechtsfrieden ihre „Kundschaft“ mit Glacéhandschuhen an. Das wird auch nicht wirklich erwartet und wäre manchmal sogar kontraproduktiv. Doch eine Minimalausstattung in Sachen Etikette dürfen auch Kläger, Beklagte und Angeklagte erwarten.
Wann der Richter zu weit geht
In folgenden Fällen wurde dies nach Ansicht anderer Richter nicht eingehalten und die Gerichte kamen aufgrund der Äußerungen von Richtern zu dem Ergebnis einer möglichen Befangenheit:
- „Sie werden sowieso fressen müssen, was ich entscheide. Und dann bleiben sie auf allem sitzen“ (BGH, Urteil v. 21.12.2006, IX ZB 60/06).
- „Ich habe jetzt keine Zeit, mich mit solchen Kinkerlitzchen aufzuhalten“ (OLG Hamburg, Beschluss v. 23.3.1992, 7 W 10/92).
- „Jetzt reicht es mir! Halten Sie endlich den Mund! Jetzt rede ich!“ (OLG Brandenburg, 15.9.1999, 1 W 14/99).
- Bezeichnung des Sachvortrags einer Partei als „Unsinn“. LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 16.6.2003, 11 AR 49/03).
Lachen und Lästern über Prozesspartei geht zu weit
Als zu weitgehend hat es das BVerfG gewertet, wenn ein Richter in der Verhandlungspause gegenüber einem Nebenintervenienten im Beisein von Gerichtsbesuchern über eine Prozesspartei lästert und damit zeigt, dass er diese nicht ernst nimmt (BVerfG, Beschluss v. 30.9.2020 20,1 BvR 495/19). Das einmalige Lachen eines ehrenamtlichen Richters am Arbeitsgericht über den Bevollmächtigten einer Partei kann die Besorgnis der Befangenheit begründen, führt aber nicht zur Amtsenthebung des ehrenamtlichen Richters (LArbG Berlin, Beschluss v. 28.12.2022, 2 SHa-EhRi 2013/22).
Befangen wegen Übersehens des Befangenheitsantrags
Auch die mangelnde Sorgfalt eines Richters bei der Lektüre des schriftsätzlichen Vorbringens der Parteien kann die Besorgnis der Befangenheit begründen. Im erstinstanzlichen Verfahren hatte ein Bevollmächtigter einer Prozesspartei diverse Verfahrensverstöße des Gerichts moniert und damit einen Befangenheitsantrag begründet. Letzteren hatte der Richter in dem 103 Seiten umfassenden Schriftsatz glatt übersehen und der Gegenpartei den Schriftsatz mit einer Aufforderung zur Stellungnahme zugeleitet. Der Richter hatte dies später damit begründet, er habe sich von der 103 Seiten umfassenden Klageerwiderung zunächst lediglich das Inhaltsverzeichnis angesehen und den gesamten Inhalt erst später zusammen mit der Replik in allen Einzelheiten studieren wollen. Dies bewertete das OLG als evident mangelnde Sorgfalt des Richters. Die betroffene Prozesspartei habe zurecht die Besorgnis, dass ihr Vortrag auch später nicht die gebührende Beachtung durch das Gericht erfahre. Der hierauf gestützte Befangenheitsantrag hatte Erfolg (OLG Karlsruhe, Beschluss v. 11.5.2022, 9 W 24/22).